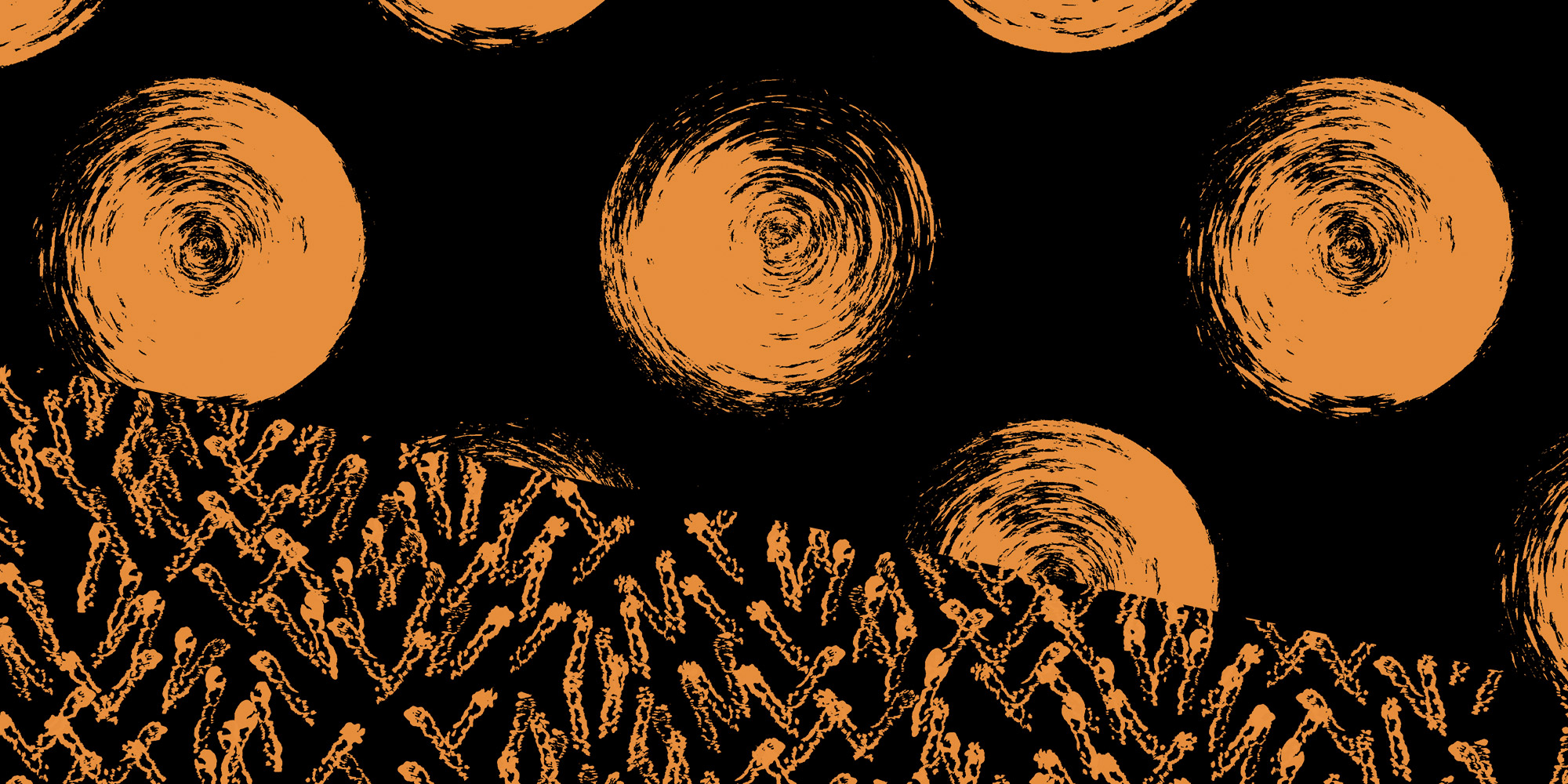Der Kibagare-Slum in Nairobi
Da wo es keine Straße mehr gibt, wo sich die dickflüssige Kloake über Lehmpfade und zwischen Müllhaufen schlängelt, wo nur noch Hütten aus Brettern, Wellblech und Plastikplanen stehen und wo es süßlich-stechend nach Fäulnis und Exkrementen stinkt, da liegt der Kibagare-Slum.
Rund 60 000 Menschen leben hier im Nordwesten der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Keine 500 Meter entfernt hat apamoyo-Vorsitzender Wim Dohrenbusch mit seiner Familie gewohnt und gearbeitet. Natürlich war der ehemalige ARD-Afrikakorrespondent neugierig, hat die Leute in dem Elendsviertel besucht und beschreibt in der folgenden Reportage das Leben auf der anderen Seite auf der anderen Seite des Kibagare-Tals.
Können diese Augen lügen? Traurig senkt der Junge seinen Blick auf seine zu großen Plastiklatschen und blinzelt durch die langen Wimpern. Nur der Hauch eines Lächelns durchzuckt die Mundwinkel. Im diesem Moment weiß er, dass er gewonnen hat. Albert heiße er, Albert Njoroge. Zwölf Jahre alt sei er, und: „Ich habe Hunger.“ Der schmächtige Kerl sieht eher aus wie Acht. Das schmutzige, rote T-Shirt ist ihm viel zu groß, zwei spindeldürre Beine wachsen aus der schlotternden kurzen Hose. Mit dem Arm wischt er sich den Rotz von der Nase und grinst über das ganze Gesicht.
Albert steht vor einem hohen Gittertor aus Eisen. Dahinter kommt ihm eine weiße Frau aus einem eleganten Haus entgegen, durchquert den Garten mit Palmen, Bougainvilla-Hecken, Swimmingpool und einem Meer aus Blumen. In den Händen hält sie eine Plastiktüte. Ein uniformierter Wachmann öffnet das Eisentor, und die Frau begrüßt den wartenden Jungen. „Schau mal Albert“, sagt sie und hält ihm die Tüte hin. „Heute gibt es Brot, Milch, und sogar ein bisschen Schokolade. Und außerdem habe ich dir ein Handtuch und Seife eingepackt. Da kannst du dich mal wieder waschen.” Albert untersucht neugierig den Inhalt der Tüte und hat es plötzlich sehr eilig. „Und wie heißt das Zauberwort“, bremst die Frau den Jungen ab. „Danke, und Gott segne dich“, sagt Albert verschmitzt, schwingt die Tüte über die Schulter und macht sich aus dem Staub.
Albert Njoroge wohnt im Kibagare-Tal, einer Hüttensiedlung neben überwucherten Bauruinen. Im Kibagare-Tal ist der Unterschied zwischen arm und reich besonders gut zu erkennen. Auf der einen Seite des Bachlaufs die winzigen Slum-Hütten aus Brettern, Wellblech, Lehm und Plastikplanen, nur ein paar hundert Meter Luftlinie auf der anderen Seite die schwer bewachten Villen in üppigen Gärten. „Green city in the sun“, die „grüne Stadt im Sonnenschein“, so heißt Nairobi auf Tourismus-Prospekten und in Reiseführern. Albert Njoroge lebt auf der Schattenseite.
„Manchmal werde ich auch verjagt“, erzählt Albert. „Dann schimpfen die Wachmänner und sagen ‚mach, dass du wegkommst. Go. go, go’.“ Aber heute hat sich der Besuch in der Welt der Reichen gelohnt. Maismehl, Bananen und Margarine hat er noch bei anderen Leuten in der Nachbarschaft abgestaubt. Das dürfte für die nächsten Tage reichen, meint er. Albert ist ein perfekter Bettler: Ein charmantes, kleines Schlitzohr, dass lustige Geschichten erzählen kann und im nächsten Moment mit großen, traurigen Augen um Hilfe bittet.
“Manchmal habe ich Angst zu sterben. Dann schwitze ich und muss zittern, und in meinem Bauch macht es ganz laut ‘dong, dong, dong’”
Vor zwei Jahren sind seine Eltern gestorben, sagt Albert. „Sie haben Changaa getrunken. Das ist selbst gebrannter Schnaps. Das Zeug war giftig, sie sind umgefallen und nicht wieder aufgestanden.“ Danach lebte Albert eine Zeit lang auf der Straße. Mal hat er in einer der Bauruinen mit anderen Kindern übernachtet, mal unter einer Plastikplane neben dem Wayaki Way, der sechsspurigen Autobahn, die Nairobi zerschneidet.
Komisch nur, dass sie – trotz der Erfolgsmeldungen in den kenianischen Medien - nach ein paar Monaten alle wieder da waren: Die Jungs, die in Westlands Erdnüsse in Zeitungspapier verkaufen oder fein herausgeputzt in Schuluniformen und mit echt wirkenden Beglaubigungsschreiben Spenden sammeln. Und auch die zwölf- und 15-jährigen Mädchen, die an der Koinjange Street auf den Strich gehen, standen wie zuvor aufgekratzt winkend an der Bordsteinkante.
Was war passiert? Phantasievolle Regierungsbeamte und Parlamentsabgeordnete hatten das Projekt leicht „modifiziert“: Sie versorgten eigene Günstlinge mit Ausbildungsplätzen und verteilten kleine Geschenke in ihren Wahlkreisen. Unterdessen saßen die meisten Straßenkinder in Gefängnissen, um anschließend von den Syndikaten der Kleinkriminellen wieder aufgesaugt zu werden. Das Wunder entpuppte sich als Mogelpackung, das Projekt war gescheitert.
Albert Njoroge wohnt jetzt mit seinem Bruder Robert und dessen Freundin Anne zusammen in einem fensterlosen Loch im Kibagare-Slum. Ein winziger Raum, vielleicht sieben Quadratmeter groß. Fensterlos, der Boden aus Lehm gestampft, kein Strom, kein Wasser. Der einzige Luxus: Ein kleines Transistorradio, das mit zwei Drähten an eine alte Autobatterie geklemmt ist. Als Albert mit seinen Plastiktüten nach Hause kommt, kniet Anne auf dem Fußboden und wäscht Hemden in einer Plastikschüssel.
“Es ist ganz wichtig, dass Albert etwas heranschafft“, sagt die 18-jährige Anne. „Das Geld reicht nie zum Leben, und ich hab’ keine Arbeit.“ Der einzige, der gelegentlich ein paar Schillinge nach Hause bringt, ist sein Bruder, erzählt Albert. „Manchmal kann er in Westlands, auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt Autos waschen.“ So kommen für die drei Personen im Monat ungefähr 15 Euro zusammen. Bevor sie mit Robert gegangen ist, hat Anne eine Weile lang abends vor einer Bar in Westlands gebettelt. Dafür musste sie den allgegenwärtigen Wachmännern gefügig sein. Über Alberts Eltern weiß sie nichts Genaues. Die Mutter soll schon vor einer Weile nach Nakuru aufs Land abgehauen sein. Die Schnapsbrennerei hat wohl eine Tante betrieben. Die sei jetzt im Gefängnis, heißt es, sagt Anne.
Albert kann keine Sekunde stillsitzen. Jeder Satz wird von seiner zappelnden Gestik begleitet. Nachts kann er vor Hunger oft nicht schlafen. „Manchmal habe ich Angst zu sterben. Dann schwitze ich und muss zittern, und in meinem Bauch macht es ganz laut ‘dong, dong, dong’.“ Vor lauter Bauchschmerzen kann er sich in der Schule nicht konzentrieren, und wenn er kein Geld für Hefte und Bücher hat, was eher der Normalfall ist, dann schicken ihn die Lehrer wieder nach Hause.
Von der europäischen Frau, bei der er sich samstags seine Plastiktüte abholt, bekam er neulich 150 Schillinge für einen Schulausflug geschenkt. Als Albert das Geld bei seiner Lehrerin abgeliefert hatte, gab die ihm einen Zettel mit einer Nachricht für die weiße Lady mit. Darin hatte sie um ein Treffen gebeten und der Frau von den Nachhilfestunden erzählt, die sie Albert gelegentlich gibt. Kostenlos. Aber jetzt wäre es doch nett, wenn die Gönnerin ihr die Stunden rückwirkend bezahlen würde.